Umfassende Cyber Security: Das Zusammenspiel aus Versicherung und modernen Sicherheitsmaßnahmen
Redaktion Digital Chiefs
Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland sehen durch Cyberangriffe ihre wirtschaftliche Existenz ...
Mitten in der Corona-Pandemie hat IDC die Umsetzung von Industrial IoT (IIoT) in deutschen industriellen und industrienahen Unternehmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass IIoT-Projekte für die Betriebe immer bedeutsamer werden – sowohl für das Tagesgeschäft als auch für die strategische Entwicklung hin zu neuen Geschäftsmodellen und IoT- Ökosystemen. Zudem bringt vor allem eine Technologie IoT-Initiativen einen zusätzlichen Schub: Edge Computing macht IoT-Umgebungen wesentlich flexibler und erlaubt komplett neue innovative Einsatzszenarien.
Durch die Vernetzung von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und der Produkte selbst können Produktionsumgebungen und Wertschöpfungsketten dank IIoT immer ausgeklügelter gestaltet werden. An allen Stellen werden Daten erfasst und an übergeordneter Stelle für bessere oder neue Erkenntnisse zusammengeführt und analysiert. Nach der Analyse werden viele Informationen und Ergebnisse meistens wieder an die Endgeräte und Maschinen zurückgespielt, was zwei Probleme eröffnet: Was passiert, wenn die notwendigen Informationen schneller gebraucht werden, als sie verschickt werden können und was passiert, wenn Netzwerk oder Rechenzentrum komplett ausfallen sollten? Diese kritischen Lücken können mit Edge Computing geschlossen werden, indem die Daten direkt im Endgerät erfasst und verarbeitet werden. Dadurch können nicht nur temporäre Ausfälle überbrückt und eine dauerhaft schlechte Konnektivität umgangen, sondern auch neue Anwendungsmöglichkeiten durch die direkte Verarbeitung am Edge ermöglicht werden.
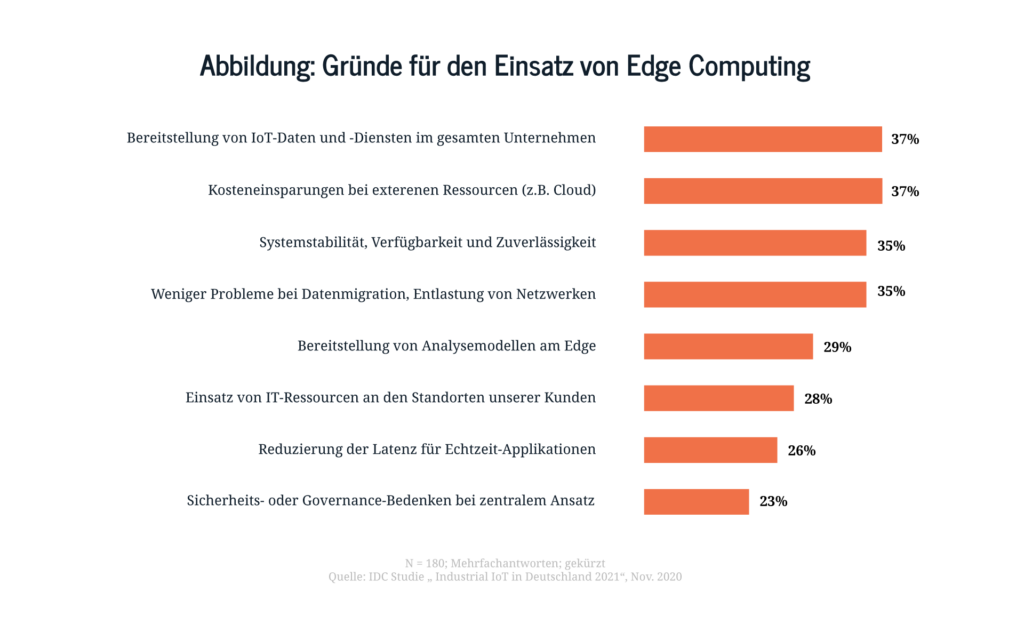
Die Ergänzung der IoT-Umgebung um Edge Computing ermöglicht eine deutlich feinere und differenziertere Gestaltung von kleinen und kompakten wie auch großen und dezentralen IoT-Landschaften – zusätzlich zu den Vorteilen bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Datenmengen. Besonders relevant sind diese Eigenschaften daher für großflächige Anwendungen, die dennoch eine hohe Performance benötigen, wie beispielsweise das autonome Fahren, welches interessant für Unternehmen aus den Bereichen Automotive oder Transport, Verkehr und Logistik ist. Aber auch für kleinere Flächen mit hohen Gerätezahlen, großen Datenmengen und verschiedenen Performanceanforderungen, wie zum Beispiel in automatisierten Fabriken von Fertigungsunternehmen, bietet Edge Computing Vorteile. Besonders hohes Potential birgt Edge Computing auch für Ver- und Entsorger, um weit verteilte Assets zu vernetzen, zum Beispiel in Fällen mit Mobilitätsanforderungen (z. B. Abfallfahrzeuge), höheren Latenzanforderungen (z. B. Stromnetzbetrieb in der Mittel- und Niederspannung) oder größeren Datenmengen (z. B. Smart Grids).

Edge Computing – in Kombination mit IIoT-Technologien, AI/ML und anderen IT-Technologien – fördert den Datenaustausch im gesamten Unternehmen und schafft schlussendlich unzählige Möglichkeiten für die Datengenerierung und neue Datenkombinationen. Das fördert Innovation und bildet die Basis für neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Nahe liegt beispielsweise die Monetarisierung von Daten und Analysen oder das Angebot neuer Dienstleistungen wie Predictive Maintenance. Perspektivisch werden aber auch immer mehr Product-as-a-Service und „Hypercustomized/Hyperlocal Manufacturing“-Geschäftsmodelle geschaffen werden.
In Zukunft werden zudem viel mehr Produktentwicklungen auf Co-Innovationen basieren, also dem gemeinsamen Entwickeln von Innovationen mit anderen Marktteilnehmern. Das können Partner, Zulieferer oder Forschungsinstitute sein oder auch Wettbewerber in Form von „Coopetition“. Voraussetzung hierfür ist, dass Daten geteilt werden können. Auch hierfür legt Edge Computing die Grundlage, indem es Unternehmen ermöglicht, Daten besser miteinander zu teilen, sie zu kombinieren oder eigene Services in Produkten der Partner zur Verfügung zu stellen. Immer mehr physische Produkte werden somit zukünftig zu „Service-Plattformen“ von IoT-Ökosystemen am Edge. Beispiele dafür können intelligente Fahrzeuge, integrierte Maschinen und Werkzeuge oder AR/VR-basierte Datenbrillen sein. IDC geht davon aus, dass 20 Prozent des weltweiten Umsatzwachstums bereits im Jahr 2025 auf solchen neuen Kombinationen digitaler Services verschiedener Branchen basieren werden.
Quelle: Adobe Stock / Gorodenkoff